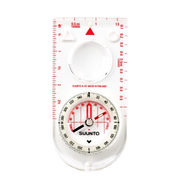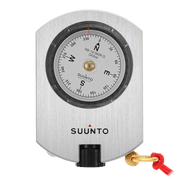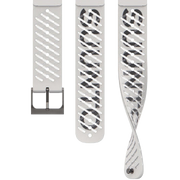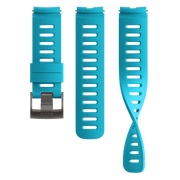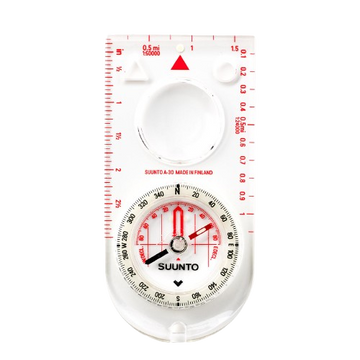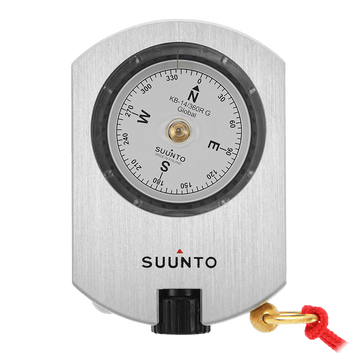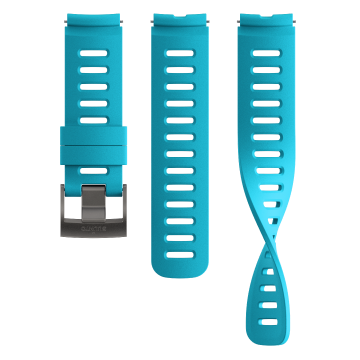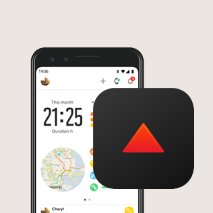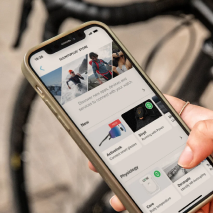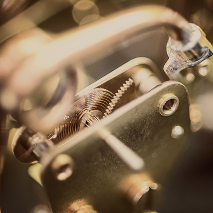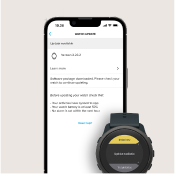Was bringt jemanden dazu, um 6 Uhr morgens durch frostige Straßen zu laufen, während ein anderer einen 50-km-Ultralauf in den Bergen in Angriff nimmt? Warum laufen wir? Wie Dr. Neil Baxter zeigt, sind die Antworten alles andere als einfach.
Dr. Neil Baxter ist Sozialwissenschaftler und begeistert sich für das Laufen – nicht nur als Sport, sondern auch als kulturelles Phänomen. Nach einem fünfjährigen Forschungsprojekt zur britischen Laufkultur an der Universität Warwick veröffentlichte er seine Erkenntnisse in einem Buch zu diesem Thema . In einem kürzlich gehaltenen Vortrag entschlüsselte er das komplexe Netz der Motivationen, die Menschen zum Laufen antreiben – und wie sich diese Gründe im letzten Jahrhundert dramatisch verändert haben.

Von der Laufbahn zum Trail: Wie sich das Laufen verändert hat
Stellt man sich einen Läufer in den 1950er-Jahren vor, denkt man wahrscheinlich an einen jungen, weißen Mann – vielleicht einen Universitätssportler, der ernsthaft auf der Jagd nach Streckenrekorden war. Laufen war damals weitgehend eine Domäne der wenigen Wettkampfsportler. Freizeitjogger, als sie in den 1960er-Jahren in den amerikanischen Vorstädten auftauchten, waren so unbekannt, dass einige von der Polizei angehalten wurden. Die Gesellschaft wusste nicht recht, was sie von Menschen halten sollte, die langsam die Straße entlangliefen, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben.
Heute ist dieses engstirnige Bild des Läufers explodiert und hat sich zu einem Kaleidoskop der Vielfalt entwickelt. Wir verbinden Laufen heute mit Menschen aller Herkunft und Körpertypen. Wir laufen auf Stadtstraßen, Parkwegen, Waldwegen. Manche jagen persönlichen Bestleistungen hinterher, manche laufen, um geistig klar zu kommen, andere, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln – oder einfach, um sich in der Natur lebendig zu fühlen.
Gesundheitskrisen, spirituelle Höhenflüge und sozialer Status: Die Motivationen im Laufe der Zeit
Der anfängliche Laufboom in den 1960er-Jahren in Amerika war vor allem eine Reaktion auf zunehmende Gesundheitsprobleme, insbesondere Herzkrankheiten im Zusammenhang mit Bewegungsmangel. Als Joggen – auch dank der Bemühungen von Nike-Mitbegründer Bill Bowerman – ins öffentliche Bewusstsein rückte, versprach es, die Kontrolle über das eigene Wohlbefinden zurückzugewinnen. Doch Laufen wurde nicht nur zu einer Lösung für die körperliche Gesundheit; es gewann bald eine tiefere Bedeutung.
In den 1970er Jahren hatte sich das Laufen in die Gegenkultur eingewoben, mit Büchern wie The Zen of Running Es wurde als spirituelle Übung dargestellt. Das „Runner’s High“ wurde nicht nur als chemischer Rausch, sondern als transzendente Erfahrung gesehen – „ein Aufblühen neuer Farben in der Seele“, wie es ein Autor ausdrückte.
Gleichzeitig wurde das Laufen von der aufstrebenden Klasse ambitionierter Berufstätiger übernommen. Es wurde zum Symbol individueller Disziplin, Selbstständigkeit und Erfolg – Ideale, die mit den aufkommenden neoliberalen Werten übereinstimmten. Manche von ihnen erkannten sich durch das Laufen als Teil einer neuen körperlichen Elite.
Der Marathon entwickelte sich in den 1980er Jahren zum ultimativen Leistungssport. Die Teilnehmerzahlen stiegen rasant an – vor allem unter männlichen Führungskräften, die einen kontrollierten, aber intensiven Härtetest suchten. Frauen hingegen waren von vielen dieser Läufe noch immer ausgeschlossen: Der olympische Frauenmarathon fand erst 1984 statt.
Das änderte sich Anfang der 2000er Jahre. Eine neue Teilnehmerwelle – diesmal angeführt von Frauen – veränderte den Laufsport erneut. Inklusivere Veranstaltungen und breitere Motivationen kamen ins Spiel: Volksläufe, Wohltätigkeitsläufe, Color Dashes und Gemeinschaftsveranstaltungen zogen Menschen an, die weniger vom Wettkampf, sondern mehr von sozialen Kontakten, körperlicher Gesundheit und Freude getrieben waren.
Als Marathons zugänglicher wurden, wechselten einige Wettkampfläufer zu extremeren Formaten – wie Ultramarathons und Bergläufen. Laut Neils Forschung sind diese Laufformen immer noch überproportional von derselben einkommensstärkeren, männlichen Bevölkerungsgruppe vertreten, die in früheren Jahrzehnten die Marathons dominierte. Laufen, selbst in seinen härtesten Formen, blieb eine Plattform für den Ausdruck von Identität, Werten und sogar sozialer Zugehörigkeit.
Warum also Du laufen?
Die Daten von Neil Baxter unterstreichen, was viele von uns instinktiv spüren: Es gibt nicht nur einen Grund, warum Menschen laufen – es gibt viele, die sich oft überschneiden.
Die meisten Läufer nannten laut seiner Umfrage allgemeine Fitness und emotionales Wohlbefinden als Hauptmotivatoren. Weniger als ein Viertel gab an, dass Wettbewerb ein sehr wichtiger Antrieb sei. Auch Geschlecht und Alter spielten eine Rolle: Männer nannten eher Wettbewerb und Geschwindigkeit, während Frauen körperliche und geistige Gesundheit priorisierten. Interessanterweise stellten ältere Läufer – insbesondere die über 70-Jährigen – einen Anstieg sozialer Motivationen und Gemeinschaftsgefühle fest.
Auch die Motivationen variieren je nach Laufart. Leichtathleten sind eher wettbewerbsorientiert und gesellig, während Berg- und Trailläufer die Natur lieben. Jogger (nicht wettkampforientierte Läufer) legen Wert auf ihr Aussehen, und Hindernisläufer nennen oft Spenden für wohltätige Zwecke.

Die vielen Gesichter – und Gründe – des Laufens
Vom Spitzenathleten bis zum Freizeitjogger, vom Pendler in der Stadt bis zum Ultraläufer in der Wildnis – Laufen ist zu einer vielseitigen Aktivität geworden, die für jeden etwas bietet. Seine Bedeutung beschränkt sich nicht mehr nur auf Podestplätze oder persönliche Rekorde.
Neil Baxter drückt es so aus: „Mit dem einfachen Akt, einen Fuß vor den anderen zu setzen, sind viele Ideen, Bedeutungen oder Formen der Bedeutsamkeit verbunden.“ Laufen ist heute so vielfältig wie die Menschen, die es tun – und so komplex wie das Leben, das sie führen.
Ob du läufst, um dich zu messen, den Kopf freizubekommen, dich stark zu fühlen oder Teil von etwas Größerem zu sein – dein Grund ist gültig. Und genau wie der Sport selbst kann sich dein Grund mit der Zeit ändern – weiterentwickeln.
Denn letztendlich haben wir alle unser eigenes Tempo, unseren eigenen Weg und unser eigenes Ziel. Kurz gesagt: Erzählen Sie Ihre eigene Geschichte.